|
Die Sprache
Gespräche mit Sterbenden sind Gespräche
von höchstem Schwierigkeitsgrad. Es gibt keine Situation zwischen
Arzt und Patient, in der Worte mit größerer Behutsamkeit, Vorsicht
und Sparsamkeit verwendet werden müssen. Von dem Onkologen Th. E.
BREWIN stammt die kurze Formel: "Sag genug, aber nicht zuviel." Die richtige
Wahl von Zeitpunkt, Thematik und Gesprächsumfang setzt ein Höchstmaß
an Einfühlungsvermögen voraus. Der Arzt muss ausloten können,
wann, worüber und wie lange ein Patient in der letzten Lebensphase
wirklich sprechen will.
Im Gespräch mit Todkranken und Sterbenden
hat das "Wie" Vorrang vor dem "Was". Hier kommt der Echtheit des Gesprächs
größte
Bedeutung zu. Alle Gespräche, die professionell, fassadenhaft, gekünstelt
oder routiniert ablaufen, sind fehl am Platz.
In diesen Gesprächen gilt das Prinzip
der völligen Klarheit der Sprache nur bedingt. Natürlich sollen
auch die Gespräche mit Todkranken und Sterbenden von Offenheit bestimmt
werden und ein vernünftiges Ausmaß an Information bieten. Aber
Information darf nicht auf Kosten der Hoffnung und für den Preis des
Entsetzens gegeben werden. Die Formulierung "nicht gutartiges Gewebe" beinhaltet
praktisch die gleiche Information wie "Krebszellen", ist aber möglicherweise
weniger belastend. Und die Aussage, dass die "Zeit begrenzt erscheint",
ist vielleicht leichter zu verarbeiten als der Hinweis auf den "nahen Tod".
Sterben und Tod bergen Schrecken genug
und sind mit stark angstbesetzten Assoziationen verbunden. Daher fällt
dem Arzt in dieser Situation in besonderem Maße die Aufgabe zu, durch
die Sprache nicht noch zusätzlich Ängste zu induzieren. Natürlich
bedeutet dies nicht, dass der Arzt nur Euphemismen benutzen soll. Aber
im Gespräch mit dem bereits aufgeklärten Patienten wird wahrscheinlich
das Wort "Krebs" nicht mehr fallen müssen, damit der Patient versteht,
was gemeint ist, wenn der Arzt von "dieser Krankheit" spricht. Der Arzt
kann seinem Patienten deutlich machen, dass er und seine Helfer alles nur
Erdenkliche tun werden, um die zu erwartenden "Beschwerden" so gering wie
möglich zu halten, ohne von "Schmerzen" zu reden. Pathologisch-anatomische
Begriffe sind häufig angstinduzierend und können weitgehend aus
dem Vokabular gestrichen werden. Auch ohne Begriffe wie "Metastase", "Tumorzelle"
oder "Knochenherd" zu verwenden, ist es möglich, mit dem Patienten
offen zu sprechen. Will der Patient Genaues wissen, wird ihm eine "Mitbeteiligung"
eines Organs oder eine "Veränderung" meistens ebenso viel sagen wie
"Lebermetastase" oder "Knochenherd", ganz zu schweigen davon, dass Detailbeschreibungen
wie "zerfallender Lungentumor" oder "verstopfter Gallengang" die Vision
eines Obduktionsbefundes beim Patienten heraufbeschwören können.
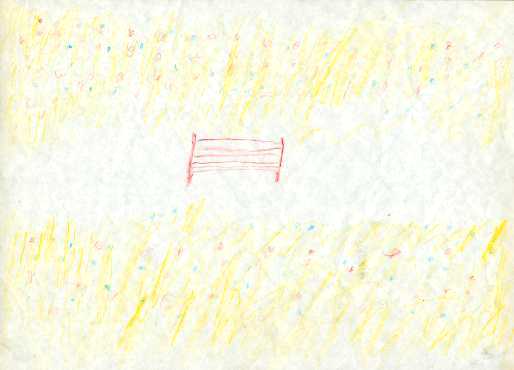
Zeichnung eines 59jährigen
Krebskranken (hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom) vier Tage vor seinem Tode.
Auf Befragen gab er folgende
Interpretation: Dies ist ein blühendes Getreidefeld mit vielen Kornblumen.
In der Mitte, das ist die Bank, auf der ich endlich ausruhen möchte
...
Es ist durchaus legitim, auch nur marginal
günstige Ergebnisse im Krankheitsverlauf, wie vorübergehende
Fieberfreiheit, Normalisierung bestimmter Laborwerte, leichte Gewichtszunahme
usw., hervorzuheben. Sie sind der Stoff, "aus dem die Hoffnung ist". Auch
unvermeidbare ungünstige Nachrichten oder Befundverschlechterungen
sollten immer mit einem Funken Hoffnung verbunden werden, wie beispielsweise
mit dem Hinweis auf einen anderen Kranken, bei dem in der gleichen Situation,
wenn auch nur vorübergehend, eine deutlich günstige Entwicklung
oder ein Rückgang der Beschwerden beobachtet werden konnten. Gerade
in Anbetracht der Rückschläge und Komplikationen bei der Betreuung
Todkranker und Sterbender muss der Arzt es lernen, im Gespräch nicht
seine eigene Ohnmacht auf den Kranken zu projizieren. Besonders in
den frühen Phasen des Wissens um die Unheilbarkeit seiner Erkrankung
muss dem Patienten immer wieder versichert werden, dass unheilbar nicht
damit gleichzusetzen ist, dass nun "nichts mehr gemacht werden kann", sondern
dass es zahlreiche Möglichkeiten der Hilfe, Beschwerdelinderung, Entlastung
und Stützung gibt und die Devise für die weitere Betreuung lautet,
dass alles Menschenmögliche getan wird. Auch das vorsichtig eingesetzte
Bild kann hilfreich sein. Dass der Tod "noch meilenweit entfernt ist",
ist als Aussage wahrscheinlich erträglicher als Angaben über
die statistische Lebenserwartung. SAUERBRUCH soll auf die Frage des sterbenden
Hindenburg, wie nahe der Tod wirklich sei, geantwortet haben: "Er ist noch
nicht im Zimmer, Exzellenz, aber er geht ums Haus."
Wenn der Patient im Augenblick nicht sprechen
möchte, weil er erschöpft oder aus anderen Gründen nicht
gesprächsfähig ist, soll der Arzt diese Haltung akzeptieren,
aber ein "zweites Angebot machen": "Wenn Sie möchten, besuche ich
Sie später noch einmal..." oder "Sollen wir vielleicht besser morgen
weiter darüber sprechen?" Der Kranke weiß dann, dass sein Wunsch,
jetzt ungestört zu sein, respektiert wird, der Arzt ihm aber trotzdem
zur Verfügung steht. So sehr der Sterbende besonderer Hilfe bedarf,
so sehr ist es auf der anderen Seite auch Aufgabe des Arztes, das persönliche
Sterben nicht zu stören.
Aktives Zuhören und verstehendes
Schweigen gewinnen hier besondere Bedeutung. Nicht widersprechen oder
schweigen können Antwort genug sein. Vielfach ist die nonverbale
Kommunikation in Form von Gesten der Zuwendung im Umgang mit Sterbenden
der Sprache überlegen. Je enger sich das Verhältnis zwischen
Arzt und Patient in dieser letzten Lebensphase gestaltet, um so mehr werden
beide in Form der "schweigenden Übereinstimmung" kommunizieren können.
Möglichkeiten und Grenzen
Alle ärztlichen Bemühungen bei Todkranken
und Sterbenden laufen im Kern darauf hinaus, dem Patienten zu helfen, Formen
der Bewältigung seiner Situation zu finden. So unfasslich und unerträglich
das Wissen um den baldigen eigenen Tod auch sein kann, der Patient muss
schließlich einen Weg zur "emotionalen Anpassung" seines Schicksals
finden. Im Idealfall wird ihm vielleicht sogar die individuelle Bejahung
des Todes möglich sein. Für den Arzt ist es daher hilfreich zu
wissen, welche Faktoren diese Bewältigungsprozesse fördern.
Das Hilfs- und Forschungsprogramm "Leben
bis zum Tod" (R. C. CARY, in: E. KÜBLER-ROSS, Reifwerden zum Tode)
hat im wesentlichen ergeben, dass die emotionale Anpassung am besten
gelingt, wenn
-
die körperlichen Beschwerden möglichst
gering sind,
-
der Patient bereits früher einen engen
Kontakt zu einem friedlich sterbenden Menschen hatte,
-
der Patient religiös orientiert ist.
Auch ein höherer Bildungsgrad scheint
die emotionale Anpassung zu erleichtern. Diese Ergebnisse unterstreichen
die besondere Bedeutung einer ausreichenden und kontinuierlichen
Versorgung
mit Analgetika. Wesentlich ist die nahtlose und nicht intermittierende
Analgesie, die das ständige Auf und Ab zwischen Beschwerdefreiheit
und Schmerzspitzen vermeidet. Die Gesamtdosen an Schmerzmitteln sind bei
diesem Therapiekonzept niedriger als bei dem immer noch häufig praktizierten
Vorgehen, erst bei massiven Schmerzen zu intervenieren.
Wir wissen heute auch genauer, welche Ängste
sterbende
Patienten in erster Linie bewegen: Am häufigsten ist die Befürchtung,
anderen zur Last zu fallen, gefolgt von der Sorge, von nahestehenden Menschen
getrennt zu werden, und schließlich die Angst vor einem schmerzvollen
Tod. Für den betreuenden Arzt bedeutet dies:
Der Patient muss spüren, dass seine
Betreuung
keine Last, sondern eine ernstgenommene Aufgabe darstellt, der Kontakt
zur Familie muss so eng und großzügig
wie möglich
gestaltet werden, und der Patient muss schließlich die Gewissheit
haben, dass auch im Endstadium eine optimale Schmerzbekämpfung
gewährleistet ist.
Die Betreuung von Todkranken und Sterbenden
bedeutet auch das Sich-Kümmern um alle Details, selbst wenn sie aus
der Sicht eines Außenstehenden noch so geringfügig erscheinen
mögen. Diese Haltung macht dem Patienten deutlich, dass auch der "Rest"
seines Lebens vollkommen ernstgenommen wird und er nicht bereits auf ein
"totes Gleis" geschoben wurde.
Der todkranke Patient ist in seinen Freiheiten
meist extrem eingeschränkt. Dieses manchmal an sich schon kaum erträgliche
Maß an Unfreiheit kann etwas gemildert werden, indem man dem Kranken
alle sinnvollen Freiheiten einräumt. Dies bedeutet in erster Linie,
dass die ganze Skala der Entmündigungsstrategien, die gerade
im Krankenhaus rasch Oberhand gewinnen können, vermieden wird. Konkret
heißt dies, dass der Patient in alle medizinischen Entscheidungen
in
Grenzen des Vertretbaren miteinbezogen wird: die Abstimmung mit
ihm über den Einsatz von Analgetika und sedierenden Medikamenten,
Flexibilität, was Zeitpunkt, Art und Umfang diagnostischer
Maßnahmen anbetrifft, die Möglichkeit,
Gewohnheiten und die bisherige Lebensweise - soweit es geht - beizubehalten,
die Freiheit, Kontakte und Besuche nach eigenem Ermessen zu bestimmen.
| They also serve who only
stand and wait ... |
|
Milton
|
Die Würde des Menschen, so schwierig
dieser Begriff auch zu definieren ist, ist in der Krankheit immer bedroht
und am stärksten in der Krankheit zum Tode. Gesundheit und Heilung
sind die originären Ziele ärztlichen Handelns, aber nicht
die
einzigen. Wo Heilung nicht mehr möglich ist und der Tod in greifbare
Nähe rückt, in der "letzten großen Krise des Lebens", wenn
das Maximum an technisch-medizinischem Einsatz per saldo keinen Erfolg
bewirkt, wird besonders deutlich, wie sehr der Mensch auf den Menschen
angewiesen ist. Deshalb sind gerade auf dem Feld, wo der Arzt seine größten
Niederlagen erlebt, auch seine besten, wenngleich nicht die spektakulärsten
Siege möglich: Wenn er weiß, was den Sterbenden bewegt und sein
Verhalten bestimmt, hat er eine vernünftige Chance, durch Einfühlung,
Gespräch und behutsame Lenkung zu helfen, das Unerträgliche erträglich
und das Unannehmbare annehmbar zu machen. Vielleicht erlebt er dann das
"Wunder der kleinen Geste": Von William OSLER berichtet sein Biograph Harvey
CUSHING, dass er seine sterbenden Patienten täglich, ja mehrfach täglich
besucht habe. Einem an einem Tumor sterbenden Mädchen brachte er an
einem trüben Novembermorgen die letzte Rose aus seinem Garten und
versöhnte es so mit dem Tode.
Unter günstigen Umständen, wenn
die verbliebene Lebensspanne noch ausreicht und der Arzt im Gespräch
wirklich fähig ist, den Kranken zu stützen und zu führen,
wenn sich eine vertrauensvolle Beziehung zum Patienten und zur Familie
entwickeln lässt, kann er auch in dieser scheinbar aussichts- und
hoffnungslosen Lage so etwas wie einen Erfolg erzielen, der als "Reifsein
zum Tode" bezeichnet wird: ein Annehmen der Krankheit zum Tode. Gelingt
dies, so kann es sein, dass er nach dem Tode des Patienten von den Angehörigen
sinngemäß erfährt: "Der einzig Starke in der Familie war
eigentlich der Kranke."
Elisabeth KÜBLER-Ross machte deutlich,
dass im Umgang mit Todkranken und Sterbenden sich für den Arzt noch
eine andere neue Chance eröffnet, nämlich die zu lernen: "Wenn
ich anfing zu reden, überwanden sie sehr schnell ihre anfängliche
Scheu und ließen uns recht bald Anteil haben an der unvorstellbaren
Einsamkeit, die sie empfanden. Fremde Menschen, die wir niemals zuvor getroffen
hatten, teilten uns ihren Kummer, ihre Isolierung und ihre Unfähigkeit
mit, mit ihren nächsten Verwandten über ihre Krankheit und den
Tod zu reden. Sie drückten ihren Ärger über die Ärzte
aus, die sich nicht auf eine Ebene mit ihnen stellten, über die Pfarrer,
die sie mit der nur allzu oft
wiederholten Phrase ,Es ist Gottes Wille'
zu trösten suchten, und über ihre Freunde und Verwandten, die
sie mit dem Unvermeidlichen ,Nimm's nicht so schwer, so schlimm ist es
doch gar nicht' besuchten. Wir lernten rasch, uns mit ihnen zu identifizieren,
und wir entwickelten eine größere Sensibilität für
ihre Bedürfnisse und Befürchtungen als je zuvor. Sie lehrten
uns eine Menge über das Leben und das Sterben, und sie freuten sich
darüber, dass wir sie baten, unsere Lehrer zu sein."
Die Frage nach dem Sinn
Die Frage nach dem Sinn eines Lebens, wenn
es zu Ende geht, ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die der Patient
seinem Arzt stellen kann. Ist sie überhaupt zu beantworten? In einem
weitgefassten Sinne ja.
Vielleicht genügt es schon, dem Patienten
beim Ziehen der Bilanz zur Seite zu stehen, ohne zu werten, oder ihm allenfalls
aus der Kenntnis seiner persönlichen Geschichte heraus behilflich
zu sein, einige Akzente positiv zu setzen.
Viktor FRANKL weist darauf hin, dass die
Sinn-Frage von einem ganz anderen Standort aus gestellt werden kann: "Wir
wollen einmal überlegen, was wir tun können, wenn ein Patient
fragt, was der Sinn des Lebens ist. Ich habe Zweifel, ob ein Arzt diese
Frage im allgemeinen beantworten kann. Denn der Sinn des Lebens unterscheidet
sich von Mensch zu Mensch, von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde. Worauf
es daher ankommt, ist nicht der Sinn des Lebens im allgemeinen, sondern
vielmehr der besondere Sinn eines menschlichen Lebens zu einem gegebenen
Zeitpunkt... Da jede Lebenssituation eine Herausforderung an den Menschen
darstellt und ihm ein Problem zur Lösung vorlegt, könnte die
Frage nach dem Sinn des Lebens tatsächlich umgekehrt werden. Letzten
Endes sollte der Mensch nicht danach fragen, was der Sinn des Lebens sei,
sondern vielmehr begreifen, dass er es ist, der gefragt wird. Mit einem
Wort: Jeder Mensch wird vom Leben befragt; und er kann dem Leben nur antworten,
indem er für sein eigenes Leben antwortet. Dem Leben kann er nur antworten,
indem er sich verantwortlich verhält."
Die Erfahrung zeigt, dass viele Patienten,
die wissen, dass der Tod unausweichlich ist, eher Fragen nach dem Prozess
des Sterbens als nach dem Sinn des Lebens stellen und was wohl nach dem
Tode kommt. Wenn aber der Patient wirklich nach dem Sinn des Lebens fragt,
könnte eine Antwort darin bestehen, ihm die Fragestellung "verändert"
zurückzugeben und ihn antworten zu lassen auf die Frage: "Welchen
Sinn habe ich für das Leben, d.h. für meine Mitmenschen
gehabt?" Wahrscheinlich finden sich dann in jeder Biographie Antworten,
die zeigen, dass keine Existenz wirklich ohne Sinn ist.
Ein Krankheitsbericht
Den Schluss dieses Kapitels bildet ein Krankheitsbericht,
der möglicherweise besser als allgemeine Betrachtungen zeigt, dass
der Arzt, auch wenn er konkrete Therapiemaßnahmen nicht mehr anbieten
kann, im Umgang mit seinen todkranken Patienten nicht mit leeren Händen
dastehen muss. Sicher waren die Voraussetzungen in diesem Fall besonders
günstig:
Eine meiner langjährigen Patientinnen,
eine 57jährige Dame, die mich in größeren Abständen
wegen eines leichten Asthma bronchiale konsultierte, kam nach längerer
Zeit wieder in meine Sprechstunde wegen "Müdigkeit in den letzten
Monaten und etwas Gewichtsverlust". Schon bei Betreten des Sprechzimmers
war unverkennbar, dass sie vom Tode gezeichnet war. Die klinische Untersuchung
ergab den dringenden Verdacht auf eine ausgedehnte intraabdominelle Tumorausbreitung
mit Lebermetastasen und Aszites. Bereits während dieser Untersuchung
bat mich die Patientin, "ehrlich" zu sein, denn möglicherweise sei
es "ja etwas Schlimmes", was hinter ihrer Müdigkeit stecke. Ich antwortete,
dass ich auch diese Möglichkeit nicht ausschließen könne,
und schlug ihr eine kurze stationäre Untersuchung vor. Als Primärtumor
ergab sich ein nicht wesentlich stenosierendes Sigmakarzinom mit ausgedehnten
Lebermetastasen, Aszites und mehreren Lungen- und Knochenmetastasen. Gemeinsam
mit dem Ehemann, einem Zahnarzt, besprachen wir die Befunde.
Die Patientin bat mich um eine offene Antwort
auf die Frage: "Habe ich Krebs?" Ich bejahte die Frage, aber in der Folgezeit
war dann in allen Gesprächen immer nur von "der Krankheit" oder "dem
Krankheitsprozess" die Rede. In diesem Gespräch gingen wir noch nicht
auf Behandlungsmöglichkeiten ein. Ich bot dem Ehepaar an, in den nächsten
Tagen selbst einen Termin zu bestimmen, an dem wir über die therapeutischen
Möglichkeiten und Aussichten sprechen könnten. In der Zwischenzeit
könne ich jederzeit telefonisch angerufen werden. Das Ehepaar bat
2 Tage später um einen neuen Termin. Die Phase der Auflehnung schien
nur kurz gedauert zu haben und bestand vor allem darin, dass ein Heilpraktiker
befragt und ein befreundeter Chirurg des Ehepaares konsultiert und gebeten
wurde, mich anzurufen.
Beim darauffolgenden Gespräch erklärte
ich in groben Zügen die Möglichkeiten einer Chemotherapie mit
einer "gewissen Chance, den Krankheitsprozess zurückzudrängen".
Auch über die prophylaktische Anlage eines Anus praeter wurde gesprochen.
Die Patientin und ihr Ehemann erbaten sich erneut Bedenkzeit.
Beim nächsten Gesprächstermin
fragte die Patientin mich, ob die Behandlung eventuell noch 14 Tage hinausgeschoben
werden könnte. Wenn dies der Fall sei, würde sie gerne gemeinsam
mit ihrem Mann einen 14tägigen Urlaub an der See verbringen. Ich riet
zu dem Urlaub und versicherte ihr gleichzeitig, dass sie mich auch aus
dem Urlaub jederzeit anrufen könne, wenn weitere Fragen auftauchen
sollten, insbesondere aber, wenn Beschwerden aufträten. Die Patientin
rief mich jedoch nur einmal kurz vor Ende des Urlaubs an und erzählte
mir, es sei "der beste Urlaub seit Jahren", den sie mit ihrem Mann verbracht
habe, Appetitlosigkeit und Müdigkeit hielten sich in Grenzen. Sie
wollte wissen, ob es vertretbar sei, noch eine Woche länger zu bleiben.
Wir vereinbarten die Verlängerung des Urlaubs um eine Woche.
Danach besuchte mich die Patientin wieder
und bat mich um meine ehrliche Meinung, ob eine Behandlung "überhaupt
unbedingt erforderlich" sei. Sie habe zwar jetzt leichte Leibbeschwerden,
aber vielleicht wäre ein Versuch zu Hause mit Schmerzmitteln gerechtfertigt.
In Anbetracht der weitgehend fortgeschrittenen Tumorkrankheit stimmte ich
dieser Behandlung zu. Wir arbeiteten einen genauen Plan für eine kontinuierliche
Analgesie mit oral zu verabreichenden Analgetika aus.
14 Tage später kam die Patientin wieder
in die Sprechstunde und sagte: "Es geht ganz gut mit den Schmerzmitteln."
Am Tag zuvor hatte mich der Ehemann aufgesucht und mir berichtet, wie unerträglich
ihn die Krankheit seiner Frau belaste, dass aber auch er der Ansicht sei,
dass sie mit kontinuierlicher Gabe von Schmerzmitteln zu Hause am besten
aufgehoben sei.
Wenige Tage später ließ sich
die Patientin noch einmal in die Sprechstunde bringen, berichtete, dass
die Schmerzen jetzt stark seien, aber dass sie unter konsequenter Analgetikatherapie
damit "leben" könne. Mit großer Gelassenheit sagte sie dann
einen für diese Phase bezeichnenden Satz: "Alle weinen - nur ich nicht."
24 Stunden später starb sie zu Hause an einer fulminanten Lungenembolie.
Linus
Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,
Frankfurt a. Main, 1992
©
Pharma Verlag Frankfurt
Autorisierte
Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de
|