| Bedenkt man das menschliche
Dasein, |
| so ist es viel erklärungsbedürftiger, |
| dass der Mensch meist
keine Angst hat, |
| als dass er manchmal
Angst hat. |
|
Schneider,
1967
|
-
Ängste, die durch ein gigantisches Potential
an Technik induziert werden;
-
Ängste, die aus Gesprächsdefiziten
oder
der Missverständlichkeit der Sprache resultieren;
-
die atmosphärische Angst, die vom modernen
Krankenhaus
ausgeht;
-
Ängste, die die Helfer verbreiten, indem
sie Kranke in einem Klima der Unpersönlichkeit und Hektik
versorgen;
-
Krebsangst und die Angst vor der Intensivmedizin;
-
Ängste, in eine nicht mehr durchschaubare,
nicht mehr selbst beeinflussbare "Mühle oder Apparatur" zu geraten;
-
Ängste durch negative medizinische
Erfahrungen;
-
Ängste, die die eigenen Ängste
des Arztes reflektieren;
-
Ängste, die von den Medien geschürt
werden;
-
Fundamentalängste vor dem Verlust
des Habens und Seins.
Hinzu kommen vielfältige Verlustängste,
die
aus dem Kranksein selbst resultieren: die Angst vor dem Verlust körperlicher
Integrität, sozialer Geborgenheit, wirtschaftliche Absicherung, schließlich
die Angst vor dem Verlust des eigenen Daseins.
Neueste Untersuchungen zeigen, dass die
Zahl der Angst-Patienten in der Praxis des niedergelassenen Arztes zunimmt
(H. RIEBELING). Vielfach handelt es sich um Patienten mit relativ unklarer
Symptomatik. Die klassischen neurotischen Ängste, wie die Herzangst
oder die Kantzerophobien, scheinen eher seltener zu werden. ENGELHARDT
und Mitarbeiter haben analysiert, wie häufig Ängste bei Krankenhauspatienten
auftreten.
Die Interviewer beurteilten die Angstreaktion von Krankenhauspatienten
einer Inneren Abteilung nach den Kategorien "gefasst", "ängstlich",
"große Angst". Als "gefasst" wurden die Patienten eingestuft, die
wussten, dass sie eine benigne Erkrankung hatten und die die geringen Auswirkungen
deshalb gut beurteilen konnten. Auch Patienten, die erfolgreich unangenehme
und bedrohliche Krankheitssymptome abgewehrt hatten, wurden in diese Kategorie
eingereiht. Unter einer "ängstlichen" Reaktion wurde verstanden, dass
Patienten bedrohliche Folgen ihrer Krankheit befürchteten, sie aber
bewältigen konnten. "Große Angst" wurde bei Patienten angenommen,
die ihre Existenz gefährdet sahen oder bei den die Krankheit, zu heftiger,
frei flottierender Angst führte. Die Untersuchung zeigte, dass nur
jeder 5. (21%) der untersuchten Patienten seine Krankheit gefasst aufnahm.
Ungefähr die Hälfte der Patienten (47%) zeigten ein ängstliches
Verhalten, und bei mehr als einem Viertel (30%) ließ sich große
Angst, die mit Verzweiflung oder Todesangst einherging, konstatieren. Untersuchungen
von DUFF und HOLLINGS-HEAD (1968) bei chirurgische Patienten ergaben ein
noch ungünstigeres Bild: 10% zeigten geringe (minor), 30% mäßige
(moderate) und 60% heftige (severe) Angst.
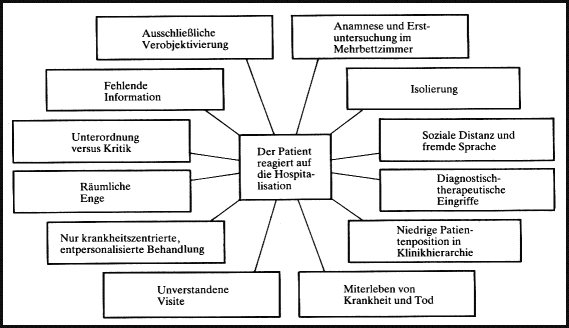 |
Abb.: Belastungsfaktoren
des Krankenhauses, auf die der Patient (mit Angst) reagiert (nach K. ENGELHARDT
und Mitarbeitern) |
Die Induktion von Angst durch die
moderne Medizin resultiert auch aus der eigenen Anonymität. Sie prägt
einerseits die Architektur ihrer Kliniken, Krankenhäuser und Praxen
und das Design ihrer Technik, andererseits auch den "Betrieb", der dort
abläuft. Die Medizin von heute ist kaum mehr in der Lage, das Gefühl
der Geborgenheit zu vermitteln. Der Patient wird zwar versorgt,
aber nicht umsorgt. Die Unwirklichkeit wird zum Charakteristikum
unserer Hospitäler, Ambulanzen und Praxen.
Die Angst, mit der ein Patient auf seine
Krankheit, die ihn versorgende Institution und die ihn Betreuenden reagiert,
muss nicht immer eine adäquate Reaktion sein. Es kann sich um den
Ausdruck eines unbewusst motivierten Konflikts handeln, dessen Ursprung
in der Vergangenheit liegt und für den die Krankheit nur als auslösendes
Moment zu betrachten ist. In diesen Fällen erscheint die Angstreaktion
dann übergroß und im Vergleich zu ihrer Ursache vernunftwidrig.
Ob bei einem Patienten Angst vorliegt und wie schwer sie wirklich ist,
kann schwierig zu erfassen sein, denn wie viel von der Angst nach draußen
dringt, wird auch von der Angstabwehr des Patienten bestimmt. Typische
Abwehrformen sind Verdrängung, Verleugnung, Regression, Rationalisierung
und Projektion. Dabei handelt es sich keinesfalls um Mechanismen, die nur
bei Neurotikern, sondern durchaus auch bei "normal" strukturierten Patienten
nachweisbar sind (s.a. Kapitel "Gespräche mit Todkranken und Sterbenden"  ). ).
Zur Historie der Angst
Die Ängste des Patienten können
nicht losgelöst von zeitgeschichtlichen Strömungen gesehen werden.
Der Begriff "Zeitalter der Angst" ist zweifelsohne plakativ. Präzise
Zahlen über die Häufigkeit der Angstverbreitung sind naturgemäß
schwer zu erhalten. So streuen die Angaben über gelegentliche Angstzustände
in der klinisch gesunden Bevölkerung zwischen 10 und 40% bei Erwachsenen
(V. FAUST).
Die Historie der Angst zeigt, dass Angst
in den verschiedenen Epochen und Kulturen sehr unterschiedlich erlebt und
verarbeitet wurde. Die Phänomene Furcht und Angst sind
bereits im Altertum bei den Griechen anzutreffen. Dort sind sie an bestimmte
Situationen, Haltungen und Verarbeitungen gebunden und können als
"Teil der Ethik im Rahmen einer sozusagen als komisch geordnet interpretierten
Welt" gesehen werden (L. BEYER). Die universalisierte, viel schwerer fassbare
Angst in Gestalt einer "Weltangst" taucht später im Hellenismus und
dann im Christentum auf. Bei KIERKEGAARD, HEIDEGGER, SARTRE und JASPERS
wird Angst zum zentralen philosophischen Schlüssel. Angst wird als
Bestandteil des menschlichen Handelns, als ein Grundzug des menschlichen
Daseins begriffen. Sie ist ein Grundphänomen menschlicher Gemütsbewegung.
Die Dichotomie in Angst (unbestimmt, gegenstandslos, anonym, unmotiviert)
und Furcht (bestimmt, auf einen bedrohlichen Zustand oder eine bedrohliche
Situation gerichtet, entsprechend motiviert) wurde von KIERKEGAARD eingeleitet.
Die "Weltbezogenheit" besteht darin, dass sich der Mensch vor bestimmten
Objekten fürchtet, aber vor dem Nichts ängstigt.
Sterbens- und Todesängste haben in
unserer Zeit ein besonderes Gewicht. Im Denken der Neuzeit gewinnt die
These von der Unvorstellbarkeit des persönliche Todes ein immer größeres
Gewicht. J. AMÈRY formuliert sie mit folgenden Worten: "Dass er
aber da ist und durchaus eine Welt ohne Dasein, nicht aber sein eigenes
Nichtdasein denken kann, ist die Grundbewandtnis seiner Existenz." Diese
These von der Unvorstellbarkeit des persönlichen Todes zählt
zu den zentralen Problemen des Menschen der Gegenwart (J. E. MEYER). Die
Kompensation durch immer weiter steigenden Konsum als die wichtigste Form
des "Habens", kann nicht gelingen. Denn Konsumieren besitzt ja etwas Zweideutiges:
Es vermindert die Angst, weil das Konsumierte nicht mehr weggenommen werden
kann, aber es zwingt auch, immer mehr zu konsumieren, denn das einmal Konsumierte
hört bald auf, zu befriedigen. Der moderne Konsument könnte sich
mit der Formel identifizieren: "Ich bin, was ich habe und was ich konsumieren"
(E. FROMM).
Dem modernen Menschen fällt es sehr
schwer, seine Habe-Orientierung aufzugeben. Tiefe Angst und das Gefühl,
auf jegliche Sicherheit verzichten zu müssen, wären die Folgen.
Dieses Phänomen des Habe-Orientiertheit - im Gegensatz zur
Existenzweise des Seins - als Quelle vielfacher Ängste beschreibt
FROMM wie folgt: "Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere,
was ich habe? Nichts als ein besiegter, gebrochener, erbarmenswerter Mensch,
Zeugnis einer falschen Lebensweise. Weil ich verlieren kann, was ich habe,
mache ich mir natürlich ständig Sorgen, dass ich verlieren werde,
was ich habe. Ich fürchte mich vor diesem Verlust, vor wirtschaftlichen
Veränderungen, vor Revolution, vor Krankheit, vor dem Tod, und ich
habe Angst zu lieben, Angst vor der Freiheit, vor dem Wachsen, vor der
Veränderung, vor dem Unbekannten. So lebe ich in ständiger Sorge
und leide an chronischer Hypochondrie, nicht nur in bezug auf Krankheiten,
sondern hinsichtlich jeglichen Verlustes, der mich treffen könnte..."
Möglicherweise wird das allgemeine
Angstpotential unserer Zeit noch dadurch verstärkt, dass Angst im
gewissen Sinne ein Modesymptom ist. So stellt V. FAUST die Frage:
"Gibt es nicht Anzeichen dafür, dass wir die Angst brauchen, ja,
dass wir sie suchen, weil es uns an natürlichen Angstauslösungen
zu mangeln beginnt? Haben wir nicht eine heimliche Schwäche für
das ... schaurige Behagen - Koketterie mit der Angst?" Und ALEWYN (1971)
schreibt: "Im Zeitalter der Angst sind viele weit davon entfernt, Angst
als eine Not zu meiden und Befreiung von ihr zu begrüßen. Im
Gegenteil: Es scheint, als ob die Angst als unentbehrliches Bedürfnis
empfunden wird: Die Lust an der Angst als Koketterie mit der Angst ..."
Formen der Angst
Die Definition des Zustandes Angst
hängt vom Standort des Betrachters ab (Psychologie, Philosophie, Psychopathologie,
Theologie). Eine Definition aus ärztlicher Sicht stammt von FAUST:
"Angst ist ein unangenehmer emotionaler Zustand mit zumeist physiologischen
Begleiterscheinungen, hervorgegangen aus einem Gefühl der Bedrohung,
entweder konkret oder nicht objektivierbar."
Die Alltagsangst bezeichnet Angstzustände,
die jeder Mensch aus seinem eigenen Erleben kennt. Es sind nachvollziehbare
sinnvolle, durch Dinge, Umstände, Gefahren, Gedanken oder Glaubensinhalte
des täglichen Lebens ausgelöste Ängste (Angst vor Krankheit,
Alleinsein, Dunkelheit, Menschen, der Zukunft oder dem Sterben). Die Abgrenzung
zur neurotischen Angst ist schwierig, da es sich nicht um quantitative
Unterschiede handelt und ein Konflikt als tieferliegende Angstquelle nicht
immer eruierbar ist. Der heutige Mensch neigt zu Somatisierungstendenzen
seiner
Angst, wahrscheinlich auch, weil die Organkrankheit einen höheren
"Prestigewert" besitzt als seelische Störungen.
Der Begriff der frei flottierenden Angst
wurde
von FREUD eingeführt. Es handelt sich um eine "zwischen Normalität
und Krankheit hin- und herdiffundierende Bereitschaft, jederzeit Bedrohliches
zu erwarten und sich mit skrupulösen Gewissensängsten abzuquälen,
eine generelle Ängstlichkeit, die von spezifischen Auslösesituationen
unabhängig ist, ihr Objekt jeweils findet oder auch frei phantasiert"
(VON BAEYER, 1971).
Umschriebene, bei bestimmten Neurosen auftretende
Ängste werden als phobische Ängste bezeichnet. Am bekanntesten
sind Klaustrophobie, Platzangst, Krebsangst oder Angst vor Erröten.
Phobische Ängste können scharf auf den eigenen Körper fokussiert
werden und sich dann beispielsweise als Herzneurose manifestieren.
Die psychotische Angst, wie sie
vor allem bei Patienten mit Schizophrenie oder manisch depressiven Erkrankungen
auftritt, zählt zu den schwersten Angstzuständen. Es besteht
eine Angst vor etwas Grauenhaftem, Unfassbarem, oder es treten befremdende,
nicht nachvollziehbare Ängste in Art einer Weltuntergangsstimmung
auf. Angstzustände bilden ein zentrales Symptom vor allem der endogenen
Depression.
Körperlich begründbare Angstzustände
werden
beispielsweise im Alkoholdelir oder beim Durchgangssyndrom auf der Intensivstation
beobachtet. Die Patienten sind zeitlich und räumlich desorientiert,
verwirrt und von intensiven Ängsten erfüllt, die u.a. zu erhebliche
Aggressionen führen können.
Strategien gegen die Angst
Der "Feldzug" gegen die Angst in der Medizin
ist ein Mehrfrontenunternehmen, das sich auf 3 Hauptstrategien stützt:
-
Ängste vermeiden, statt Ängste
auszulösen.
-
Ängste erkennen und differenzieren.
-
Ängste annehmen und abbauen.
Kranksein geht schon an sich mit zahlreichen
Ängsten einher. Eine der wichtigsten Aufgaben des Arztes und seiner
Mitarbeiter muss es daher sein, das Angstpotential nicht noch durch vermeidbare
Ängste zu erhöhen. Wer imstande ist, sich in die Wirklichkeit
eines Patienten einzufühlen, der zum ersten Mal in ein Krankenhaus
eingeliefert wird, wird sich rasch ein plastisches Bild von dem Szenario
seiner Ängste machen können: Die ersten Ängste werden möglicherweise
schon durch den Transport mit heulenden Sirenen zum Hospital induziert.
Dort trifft der Patient auf lauter Unbekannte, deren Namen er nicht kennt
und deren Funktionen schwer zu durchschauen sind. Vielleicht spricht man
ihn mit seinem Namen an, vielleicht aber auch nicht, oder sein Name wird
verstümmelt. Was um ihn herum geredet wird, geschieht in einer fremden
Sprache, noch dazu in verkürzter Form. Er erlebt rasch, dass er sich
eher in der unteren als der oberen Position der Krankenhaushierarchie befindet.
Es werden Untersuchungen mit ihm angestellt. die zum Teil belästigend,
zum Teil schmerzhaft sind und deren Sinn für ihn schwer erkennbar
ist. Viele Fragen drängen sich ihm auf, aber er bekommt meist nur
wenige oder abweisende Antworten. Er erlebt sich als Objekt und muss sich
einem strengen Krankenhausreglement unterwerfen. Er liegt mit anderen Kranken
zusammen, die für ihn ebenfalls Fremde sind, und erlebt deren Krankheit,
evtl. sogar ihren Tod mit.
| Strategien gegen die Angst |
I. Ängste vermeiden!
| 1. keine Angst induzierende,
sondern
verstehende und erklärende Sprache |
| 2. Anonymität, Undurchschaubarkeit
vermeiden |
| 3. keine Verobjektivierung
oder
Isolation
des
Patienten |
| 4. Kommunikationsbarrieren
beseitigen |
| 5. eigene Ängste
erkennen und reflektieren |
|
II. Ängste erkennen
und differenzieren
1. "Masken" der Angst
erkennen:
| - "schwieriges" Verhalten |
| - Compliance-Probleme |
| - Abwehrmechanismen (Verleugnung,
Rationalisierung, Vermeidung usw.) |
| - Alkohol- und Medikamentenabusus |
2. Angst differenzieren:
| - "normale" Angst? |
| - organisch bedingte Angst? |
| - Phobie? |
| - neurotische Angst? |
| - psychotische Angst? |
|
|
III. Angst abbauen
| 1. die Angst annehmen |
| 2. die Angst aussprechen
(nicht
"ausreden") |
| 3. die Angst erklären |
| 4. Ängste zu Ende
denken lassen |
| 5. Metakommunikation |
| 6. Abwehrmechanismen nicht
unterbrechen |
| 7. verbale und nonverbale
Kommunikationsmöglichkeiten
ausschöpfen |
|
|
Natürlich ist es eine Illusion anzunehmen,
dass sich das Konzept einer angstfreien Medizin lückenlos verwirklichen
lässt. Die totale Angstfreiheit in der Begegnung zwischen Patient,
Arzt und Helfern wird wahrscheinlich bei noch so gutem Willen nicht realisierbar
sein. Es stellt sich sogar die Frage, ob nicht ein bestimmtes Quantum an
"natürlicher Angst" zur besseren Adaption in bestimmten Situationen
erforderlich ist. So hat JANIS gezeigt, dass eine mittelgradige präoperative
Furcht die bestmögliche postoperative Anpassung erlaubt. Neuere Untersuchungen
haben jedoch auch ergeben (MATHEWS und RIDGEWAY, 1981), dass Patienten
mit hochgradigen präoperativen Befürchtungen postoperativ im
Durchschnitt mehr Schwierigkeiten haben als Patienten mit einer "gesunden
" Portion präoperativer Angst. Ärztliches Handeln muss als ein
wesentliches Ziel die Verringerung des Angstpotentials in der Medizin
beinhalten. Denn erst der Mensch ohne übertriebene Angst ist in der
Lage, sich zu öffnen, zu verstehen, zu kooperieren, seine Krankheit
richtig zu verarbeiten und seine Identität wiederzufinden.
Angst, ihre Abwehr durch den Patienten
und ihre Bekämpfung durch den Arzt in speziellen Situationen wird
in verschiedenen Kapiteln dieses Buches behandelt, auf die hier hingewiesen
werden soll ("Das ärztliche Gespräch vor und während belastender
Maßnahmen"  ,
"Das Gespräch mit dem sogenannten schwierigen Patienten" ,
"Das Gespräch mit dem sogenannten schwierigen Patienten"  ,
"Gespräche in der Intensivmedizin" ,
"Gespräche in der Intensivmedizin"  ,
"Gespräche mit Todkranken und Sterbenden" ,
"Gespräche mit Todkranken und Sterbenden"  ). ).
Ängste vermeiden
Ängste lassen sich am ehesten vermeiden,
wenn alles, worüber mit dem Patienten gesprochen wird und was mit
ihm geschieht, durchschaubar und möglichst unmissverständlich
ist.
Ein erster Schritt dazu ist die Beseitigung der Anonymität
in
Praxen, Ambulanzen und Krankenhäusern: Ärzte und Helfer sollen
sich mit ihrem Namen vorstellen und ihre Funktion nennen. Der Patient soll
möglichst oft mit seinem (korrekten!) Namen angesprochen werden. Besonders
dem älteren Menschen sollen zeitliche und örtliche
Orientierungshilfen
zur
Verfügung stehen. Wichtig ist eine feste Bezugsperson innerhalb des
Ärzteteams oder des Pflegepersonals. Alles, was mit dem Patienten
geplant ist oder mit ihm unternommen wird, sollte ihm in groben Zügen
erklärt
werden.
Tagtäglich wird gegen die einfachsten Regeln verstoßen: Nicht
den Patienten nur gelegentlich ansehen,
sondern den EKG-Schreiber,
das Sonographiebild oder den Praxiscomputer. Es ist erstaunlich, wie dankbar
Patienten reagieren, wenn sie im Krankenhausflur von einem Arzt oder einer
Schwester gegrüßt
werden, die nicht zu ihrem Behandlungsteam
gehören.
Ganz entscheidend ist es, eine möglichst
wenig
angstinduzierende Sprache zu benutzen. R.S. BLACHER und H.L. LEVINE
haben in einer schönen Übersicht (The Language of the Heart)
gezeigt, wie viel Ängste alleine durch Begriffe, die das Herz betreffen,
induziert werden können: Die Bezeichnung "Herzfehler" induziert nicht
selten die Vorstellung eines terminalen Herzversagens, der Begriff "Herzblock"
löst die Vorstellung aus, dass der Blutkreislauf verstopft ist, unter
"Vorhofflimmern" versteht der Laie möglicherweise ein vollkommen unkoordiniertes
Arbeiten des Herzmuskels, der Terminus "gespaltener Herzton" kann dramatische
Vorstellungen von Rissen im Herzmuskel erwecken, und ein Patient, der etwas
von einem Loch im Herzen hört, sieht möglicherweise das Blut
aus diesem lebenswichtigen Organ in die Körperhöhlen entweichen.
Unsicherheit und Missverständnisse können durch die häufige
Verwendung von Abkürzungen (ZVD, TIA, PRIND usw.) ausgelöst werden.
Undurchschaubar wird die Situation für den Patienten, dessen Ärzte
bei der Visite nicht zu ihm, sondern über ihn oder sogar
mit anderen Patienten sprechen.
Der Patient, der nicht fragen darf,
dessen Fragen nicht beantwortet werden, dem Information verweigert wird,
der auf Kommunikationshemmnisse nach allen Seiten stößt, wird
zwangsläufig mit Angst reagieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass
beispielsweise die stärkste Belastung in der Intensivmedizin nicht
durch den technischen Aufwand, sondern durch Kommunikationsdefizite
zustande
kommt. Dies begründet eine großzügige Besuchsregelung und
ein Miteinbeziehen der Angehörigen in die Betreuung des Kranken. So
war beispielsweise der Anstoß,1977 das Wiener Modell "Psychische
Betreuung Schwerstkranker" zu entwickeln, eine 17jährige Patientin
mit hoher Querschnittslähmung nach einem Kopfsprung in niedriges Wasser:
Trotz eines maximalen technischen Aufwandes von einem Lungenschrittmacher
bis zum automatisierten Schreibsystem erlebten sich Ärzte und Pflegepersonal
hilf- und ratlos und empfanden ein Gefühl passiver Ohnmacht. Als wichtigste
positive Maßnahme erwies sich der gezielt organisierte Besuch der
Eltern. Diese durften nicht nur regelmäßig kommen, sondern wurden
von den Pflegekräften immer dann, wenn es der Patientin besonders
schlecht ging, auch nachts verständigt. Erst dadurch gelang es, die
Patientin in einen weitgehend angstfreien Zustand zu versetzen (H. BENZER).
Alles, was die äußere und
innere Isolierung des Patienten verstärkt, was ihm das Gefühl
der Verobjektivierung gibt, wirkt angstinduzierend und sollte soweit
als möglich vermieden werden. Moderne Medizin lässt sich nicht
ohne einen großen technischen Aufwand betreiben. Die Angst vor der
"Apparatemedizin" ist weit verbreitet. Der juristische Druck, eine sehr
rigide Aufklärungstechnik zu betreiben, induziert weitere Ängste.
Das optimal geführte Aufklärungsgespräch und das
einfühlende Vorbereitungsgespräch vor belastenden diagnostischen
und therapeutischen Maßnahmen können ein starkes Gegengewicht
zu diesen weitverbreiteten Quellen der Angst darstellen. Nonverbale
Signale (Lächeln, Berührung, Hautkontakt) sind einfache,
im Prinzip stets verfügbare und sehr wirksame Instrumente der Angstverhütung.
Eine ungezwungene Heiterkeit und sparsam dosierter Humor wirken ebenfalls
angstmindernd. Der Witz hingegen ist eine zweischneidige Sache, da er immer
ein "Opfer" hat, das auf keinen Fall der Patient sein sollte. Offene Zuwendung,
Dasein, Empathie und die Fähigkeit, die individuelle Wirklichkeit
des Kranken zu erfassen, sind die besten Garanten einer möglichst
angstarmen Medizin. Schließlich sollte der Arzt auch versuchen,
seine eigenen Ängste zu erkennen und zu reflektieren. Denn
gar nicht selten ist die Angst des Patienten nichts anderes als das Echo
auf die Angst des Arztes.
Ängste erkennen und differenzieren
Obwohl die heutige Medizin reich an vielfältigen
Ängsten ist, treten diese nur in der Minderzahl offen zutage.
Angst ist immer noch mit dem Etikett des Makels oder der Schande versehen.
Daher fällt es manchem Patienten sehr viel leichter, die körperlichen
Begleitsymptome
seiner Angst zu schildern, als offen zu sagen: "Ich habe Angst". Gerade
viele nachts auftretende unangenehme Zustände (Beklemmungen, Luftnot,
Herzrasen) sind körperlicher Ausdruck von Angstzuständen. In
der Regel werden jedoch die somatischen Symptome in den Vordergrund gestellt.
Die behutsam gestellte Frage im weiteren Gesprächsverlauf, ob bei
den Erscheinungen auch etwas Angst dabei war, wird dann überraschend
oft bejaht. Als nächstes sollte weiter gefragt werden, was wirklich
am
Anfang der Attacke stand, die Angst oder die körperlichen Erscheinungen.
Ängste kommen sehr häufig eher
durch das Verhalten eines Patienten zum Ausdruck als durch seine
Worte.
Das
Ablehnen von diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen ist in
einem wesentlich höheren Prozentsatz auf emotionale (Angst) als auf
rationale Gründe zurückzuführen. Begünstigt wird ein
solches Verhalten durch eine mangelhafte Aufklärungstechnik und die
unzureichende Fähigkeit zu motivieren. Viele Complianceprobleme sind
in Ängsten (z.B. vor Nebenwirkungen oder der Gewöhnung an das
Medikament) begründet. Der sogenannte "schwierige" Patient ist ein
typisches Beispiel für hintergründige und damit häufig unerkannte
Ängste: der "abhängige" Kranke, der unter Vernachlässigungs-
und Trennungsängsten leidet, der "Fordernde", der seine Wertlosigkeitsangst
zu kompensieren versucht. Andere Masken der Angst können Alkohol-
oder Tablettenabhängigkeit (Tranquilizer) sein. Immer, wenn ein Patient
sich scheinbar uneinfühlbar, irrational, ablehnend, "unbequem" verhält,
sollte die erste Überlegung dahingehen, ob sein Verhalten nicht durch
unausgesprochene oder unbewusste Ängste bestimmt ist.
Der nächste Schritt muss eine Differenzierung
der
Angst sein: Handelt es sich um Ängste, die eher im Sinne einer Furcht
eine verständliche und angemessene, das heißt "normale" Angst
bedeuten? Ist die Angst organisch bedingt? Beruhen die Ängste auf
Missverständnissen? Sind sie eine Reaktion auf die Krankheit selbst,
das Verhalten des Arztes oder der Umgebung? Handelt es sich um neurotische
oder psychotische Ängste? Ist die Angst Ausdruck einer Depression?
Eine Differenzierungshilfe bei den klinischen Angstsyndromen bietet das
folgende diagnostische Flussdiagramm von F. STRIAN.
Abb.: Diagnostisches Flussdiagramm
zur Differenzierung von Angstsyndromen (F. STRIAN)
Ängste annehmen und abbauen
Zunächst ist es ganz entscheidend, den
Patienten mit seiner Angst anzunehmen. Übersehen, Beiseiteschieben
oder Herunterspielen seiner Ängste führt in einem Circulus vitiosus
zu einer weiteren Verstärkung der Angst. Der Patient muss wissen,
dass er Angst haben darf und dass seine Angst nicht mit Schwäche,
Versagen oder Schande gleichzusetzen ist. Dazu ist es notwendig, die Angst
behutsam, aber offen anzusprechen. Durch das Aussprechen der Angst erkennt
der Patient, dass der Arzt seine Angst registriert hat und bereit ist,
auf sie einzugehen, und dass er mit seiner Angst nicht alleine dasteht.
Es ist im allgemeinen wenig aussichtsreich, zu versuchen, jemandem seine
Angst "auszureden" ("Sie brauchen aber wirklich keine Angst zu haben").
Zunächst kann es bereits hilfreich sein, im Sinne der Metakommunikation
darüber
zu sprechen, welche Ängste den Patienten bewegen. Ein wirksames Vorgehen
besteht ferner darin, dem Patienten die Entstehung
der Angst zu
erklären und ihm zu versichern, dass unter den gegebenen Umständen
eine Angst eine verständliche und adäquate Empfindung darstellt
("Ich kann durchaus verstehen, dass Sie bei dem Gedanken an ... Angst verspüren
müssen"). Es ist auch günstiger, Ängste und Befürchtungen
zu
Ende denken zu lassen, als sie vorzeitig abzublocken. Angstinhalte,
die verbalisiert sind, sind einer rationalen Bewältigung eher
zugänglich. Besonders wichtig ist es, in Situationen, die mit starker
Angst besetzt sind und gleichzeitig erhebliche Kommunikationsbarrieren
beinhalten (Intensivstation!), alle verbalen und nonverbalen Möglichkeiten
der Kommunikation auszuschöpfen.
Angstfreiheit erreichen zu wollen
kann nicht das vorrangige Gesprächsziel sein. Einmal wäre
dieses Ziel für die meisten zur Bewältigung der Angst illusionär.
Ferner ist ein bestimmter Grundpegel an "natürlicher Angst" in vielen
Situationen ein wirksamer Schutzmechanismus, beispielsweise vor Operationen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten, die vor einer Operation so
gut wie keine Angst aufweisen, postoperativ ungünstigere Verläufe
haben als Patienten mit einer "normalen" präoperativen Angst. Das
entscheidende Gesprächsziel ist vielmehr, Hilfen zu bieten, dass der
Patient selbst Möglichkeiten findet, mit seiner Angst umzugehen, so
dass er nicht die Angst ihn, sondern seine Angst beherrscht.
Beim todkranken und sterbenden Patienten
kann die Erkennung der Angst besonders schwierig sein. Vielleicht dringt
sie nur in Gestalt ihrer Abwehrmechanismen nach außen, so
dass der Arzt mit der Angst seines Patienten sehr viel mehr durch das ganze
Spektrum der Abwehrphänomene (Verleugnung, Rationalisierung, Vermeidung,
Projektion usw.) konfrontiert wird als durch das offene Angst-Eingeständnis.
Da die Abwehrmechanismen eine gewisse Kontrolle und Bewältigung der
Angst ermöglichen, sollten sie zwar als Signale der Angst erfasst,
nicht
aber
durchbrochen werden. Allerdings gelingt eine vollkommene Kontrolle der
Angst in der Regel nicht, so dass ein Anteil an unkontrollierter
frei
flottierender Angst übrig bleibt, die dann in den Behandlungsplan
einbezogen werden sollte. Die teilweise schweren Ängste des Depressiven
bedürfen natürlich ebenfalls der Annahme im Gespräch, sind
aber durch Gespräche selbst kaum zu bewältigen, sondern am wirksamsten
durch eine antidepressive Pharmakotherapie zu dämpfen. Neurotische,
insbesondere aber psychotische Ängste erfordern in der Regel eine
psychiatrische Behandlung.
Die letzten Ängste, die den Menschen
bewegen können, wenn ihn seine Krankheit unausweichlich seinem Tode
näher bringt, werden allerdings vielleicht nur aus Zuversicht zu bewältigen
sein, dass es nach dem Tode jene wirklich "Neue Welt" gibt, wo "ich ohne
Angst ich selber sein darf ..." (H. KÜNG).
Linus
Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,
Frankfurt a. Main, 1992
©
Pharma Verlag Frankfurt
Autorisierte
Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de
|