|
Die 4 Botschaften des Sprechens
Sprechen ist immer mehr als der Austausch von
Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger. Wenn ich
(Sender) spreche, verschlüssele ich mein Anliegen in erkennbare Zeichen
(Nachricht). Sie werden von meinem Gesprächspartner (Empfänger)
entschlüsselt. Hat der Empfänger meine Nachricht "richtig" entschlüsselt,
d.h., stimmen gesendete und empfangene Nachricht überein, hat eine
Verständigung
stattgefunden. Sprechen ist eben mehr als ein "Geschehen zwischen zwei
EDV-Anlagen" (R. Lay).
Der Vorgang der Übermittlung einer Nachricht
durch Sprechen enthält in der Regel nicht nur eine "Botschaft", nämlich
die Mitteilung einer Information, sondern gleichzeitig 4 Botschaften.
Sie lauten:
-
Sachinhalt (Information)
-
Selbstoffenbarung
-
Beziehung (Kontakt)
-
Appell
Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag soll dies verdeutlichen:
Die Mutter begrüßt ihren Sohn, der sie recht selten besucht,
mit dem Satz: "Schön, dass du wieder mal da bist!"
Die Anatomie dieser Nachricht lässt rasch erkennen,
dass in diesem Satz tatsächlich mehr als nur eine Botschaft steckt.
Abb.: Die 4 Seiten ("Botschaften")
einer Nachricht (modif. nach F. SCHULZ VON THUN)
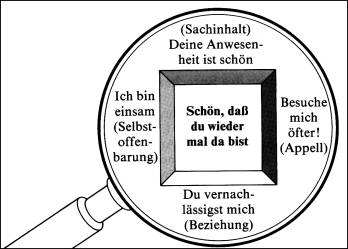 |
Abb.: Die 4 Botschaften der Nachricht
"Schön, dass du wieder mal da bist" unter der kommunikationspsychologischen
"Lupe" (modif. nach F. SCHULZ VON THUN) |
Die 1. Botschaft ist die Mitteilung eines
eindeutigen
Sachinhaltes: Die Tatsache, dass du da bist, ist schön. Wir spüren
aber natürlich sofort, dass dieser Satz mehr beinhaltet als nur eine
einfache Feststellung.
Er sagt ebenfalls etwas über den Sender der
Nachricht, die Mutter, aus. Mit dem Satz: "Schön, dass du wieder mal
da bist" spricht die Mutter auch über ihre Gefühle und damit
über sich selbst: Sie lässt erkennen, dass sie den Sohn vermisst
hat, dass sie Sehnsucht nach ihm hatte und sich jetzt freut, ihn wiederzusehen.
Sie lässt erkennen, wie ihr zumute ist. Diese Selbstoffenbarung
ist die 2. Botschaft der Nachricht.
Die 3. Botschaft sagt etwas darüber aus,
wie Mutter und Sohn zueinander stehen, wie ihre Beziehung ist. Meistens
enthält die Botschaft "Beziehung" sogar zwei verschiedene Botschaften:
Einmal drückt sie aus, was der Sender vom Empfänger hält,
und zweites, wie das Verhältnis (Kontakt) zwischen Sender und Empfänger
ist. In unserem Beispiel hat der Satz: "Schön, dass du wieder mal
da bist" einen unüberhörbaren kritischen Unterton. Die Mutter
will auch sagen: "Du kümmerst dich nicht genug um mich." Damit sagt
sie etwas über den Sohn als den Empfänger der Nachricht aus.
Gleichzeitig wird in dem Satz aber auch die Enge und Vertrautheit der Beziehung
zwischen ihr und ihrem Sohn deutlich.
Die 4. Botschaft, die in dem Satz steckt,
enthält einen eindeutigen Appell: Die Mutter will mit dem Satz
auch zum Ausdruck bringen: "Du solltest mich öfter besuchen!"
Immer, wenn wir miteinander sprechen, müssen
wir uns vergegenwärtigen, dass die Nachrichten, die wir austauschen,
mehrere Botschaften gleichzeitig enthalten, die ein sehr unterschiedliches
Gewicht besitzen können, und dass keineswegs die vordergründig
wichtig erscheinende Botschaft - meist die Information - die entscheidende
sein muss.
Kompliziert wird dieser Vorgang noch dadurch, dass
Sender und Empfänger verschiedene Botschaften einer Nachricht für
die wesentliche halten. So kann es passieren, dass der Empfänger den
Sachinhalt für die entscheidende Botschaft hält, während
es dem Sender vielmehr um die Beziehungsseite oder den Appell geht. Es
liegt auf der Hand, dass sich daraus tiefgreifende Missverständnisse
zwischen beiden entwickeln können, obwohl die gesendete Nachricht
scheinbar völlig klar und unmissverständlich ist.
Wird in unserem Alltagsspiel der Sohn lediglich mit
Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass seine Mutter sich über seinen
Besuch freut, mehr aber nicht, und sie daher auch in Zukunft nicht häufiger
besuchen, so wird diese Begegnung für die Mutter unbefriedigend sein,
weil ihr Sohn offenbar die für sie entscheidenden drei anderen Botschaften,
nämlich ihr Gefühl der Einsamkeit, ihre leise Kritik an seinem
Verhalten und ihren Appell, sie öfter zu besuchen, "nicht verstanden
hat."
Eine Grunderkenntnis der Kommunikation lautet
daher: Beim Sprechen geschehen in der Regel immer 4 Dinge:
-
Wenn ich spreche, teile ich einen Sachverhalt mit -
Information.
-
Wenn ich spreche, spreche ich auch über mich -
Selbstoffenbarung.
-
Wenn ich spreche, sage ich meinem Gegenüber, was
ich von ihm halte und wir zueinander stehen - Beziehung.
-
Wenn ich spreche, versuche ich, Einfluss auf meinen
Gesprächspartner zu nehmen - Appell.
Die Vielfalt der Botschaften soll ein anderes Beispiel,
das dem klinischen Alltag entnommen ist, deutlich machen.
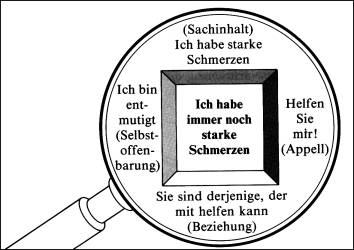 |
Abb.: Kommunikationspsychologische
Betrachtung ("Lupe") der Nachricht "Ich habe immer noch starke Schmerzen"
(modif. nach F. SCHULZ VON THUN) |
Bei der morgendlichen Visite sagt die Patientin zum
Arzt: "Herr Doktor, ich habe immer noch starke Schmerzen."
Es ist unverkennbar, dass auch diese scheinbar einfache
Information mehrere Botschaften enthält: Die Botschaft: "Ich habe
starke Schmerzen" (= Sachinhalt oder Information) ist für jeden unmissverständlich.
Die 2. Aussage über die Sprecherin selbst (= Selbstoffenbarung). Wir
können annehmen, dass die Patientin auch zum Ausdruck bringen will,
dass sie enttäuscht ist über das bisherige Ergebnis der Behandlung,
vielleicht auch entmutigt oder sogar verzweifelt. Die Tatsache, dass sie
sich mit diesem Satz an den Arzt wendet, sagt auch etwas über ihre
Beziehung zu ihrem behandelnden Arzt aus. Etwa in dem Sinn: ,Ich sage dir,
dass ich starke Schmerzen habe, weil du derjenige bist, der etwas dagegen
unternehmen kann‘. In dieser Botschaft ist aber auch etwas über das
Verhältnis der Patientin zu ihrem Arzt enthalten: ,Ich wende mich
mit meinen Schmerzen an dich, weil ich dir vertraue‘. Die Beziehungsbotschaft
enthält demnach sowohl eine Aussage darüber, was die Patientin
von ihrem Arzt hält, als auch darüber, wie sie zu ihm steht.
Die 4. Botschaft schließlich, der Appell, ist unüberhörbar:
,Du sollst mir helfen!‘
Wenn also jemand mit mir spricht und ich den ganzen
Gehalt dieser Nachricht erfassen möchte, so gelingt mir das am
besten, wenn ich mir 4 Fragen beantworte:
-
Was ist der Sachinhalt der Nachricht?
-
Was sagt sie über meinen Gesprächspartner
aus?
-
Was will mein Gesprächspartner mit dieser Nachricht
über mich und unsere Beziehung zueinander aussagen?
-
Was möchte er erreichen?
Anatomie der Nachricht
Nachricht im Sinne zwischenmenschlicher Kommunikation
ist die Gesamtheit der Botschaften, die der Sender dem Empfänger übermittelt.
Sie ist "das ganze vielseitige Paket mit seinen sprachlichen und nichtsprachlichen
Anteilen" (F. SCHULZ VON THUN).
Der Umfang einer Nachricht kann in weiten
Grenzen variieren, ohne dass eine feste Korrelation zwischen Umfang und
Informationsgehalt bestehen muss. So ist beispielsweise der Informationsgehalt
der aus nur einem Wort bestehenden Nachricht: "Hilfe!" eines Ertrinkenden
eindeutig höher als derjenige eines eine Seite langen Rundschreibens
des Elektrizitätswerks, das, genaugenommen, nicht mehr aussagt, als
dass der Strompreis in Kürze erhöht wird.
Selbst Schweigen als besondere Form des Nicht-Sprechens
stellt eine Nachricht dar. Denn Schweigen ist nicht schlechthin mit Nicht-Sprechen
gleichzusetzen, sondern Schweigen bedeutet, dass ich nicht spreche, obwohl
ich sprechen sollte oder man es von mir erwartet. Das Phänomen Schweigen
verdeutlicht sozusagen am Extrem das Grundgesetz der Kommunikation, das
WATZLAWICK (1969) auf die Formel gebracht hat: "Man kann nicht nicht kommunizieren."
Die "Nachricht" Schweigen ist von Natur aus vieldeutig
und daher für den Empfänger besonders schwer interpretierbar.
Denn was bedeutet es beispielsweise, wenn ein Patient, der gefragt wird,
wie es ihm geht, sich zur Wand dreht und schweigt? Die Selbstoffenbarungsseite
der Nachricht lautet vielleicht: "Ich fühle mich so krank, dass ich
es nicht sagen kann." Die Beziehungsbotschaften der Nachricht könnten
lauten: "Du bist nicht für mich der richtige Gesprächspartner"
- "Ich habe kein Vertrauen zu dir" - "Ich bin von der bisherigen Behandlung
so enttäuscht, dass ich dir auch nicht sagen möchte, wie es mir
geht." Die Appellseite der Nachricht heißt wahrscheinlich: "Lass
mich in Ruhe!" – "Sprich nicht mit mir!"
Für das Verstehen des Gesprächspartners
ist es wichtig zu klären, ob eine Nachricht nur explizite oder
auch implizite Botschaften beinhaltet. Mit der expliziten
Botschaft wird etwas ausdrücklich formuliert, während die implizite
Botschaft nur indirekt etwas ausdrückt. Erschwerend kommt hinzu, dass
es
tatsächliche und scheinbare explizite Botschaften
gibt.
Beispiel: Die explizite Botschaft "Ich gehe jetzt
schlafen" ist unmissverständlich. Die Botschaft "Es ist schon viertel
vor zwölf" enthält möglicherweise die gleiche Aussage, nämlich,
"Ich möchte jetzt schlafen gehen." Vielleicht hat aber der Empfänger
diese Aussage nur in die Botschaft "hineingelegt", während der Sender
möglicherweise etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen wollte, z.B.
"Es ist zwar schon viertel vor zwölf", aber ich bin noch so gut in
Schwung, dass ich weiterarbeiten will."
Alle Botschaften einer Nachricht können
explizit oder implizit sein, d.h. auf dem Feld der impliziten Botschaften
ist die Gefahr von Missverständnissen besonders groß. Es ist
lehrreich, ein x-beliebiges Alltagsgespräch auf seinen Anteil an expliziten
und impliziten Botschaften zu untersuchen. In den meisten Fällen wird
die Analyse zeigen, dass der Anteil impliziter Botschaften weitaus höher
liegt als allgemein angenommen.
Zu den Grundfähigkeiten erfolgreicher Kommunikation
gehört es, herauszufinden, welches die wirkliche Hauptbotschaft
einer
Nachricht ist. Ist es der ausdrücklich genannte Sachinhalt, oder steckt
das Hauptanliegen in der implizit gesendeten Botschaft?
Das Nichterkennen impliziter Botschaften im Gespräch
zwischen Arzt und Patient kann zu tiefgreifenden Kommunikationsstörungen
führen. Die Angabe des Patienten "Von den roten Pillen bekomme ich
so einen bitteren Geschmack im Mund" kann als rein explizite Botschaft
mit eindeutigem Sachinhalt (subjektive Medikamentenunverträglichkeit)
aufgefasst werden. Die impliziten Botschaften, die diese Nachricht - möglicherweise
- auch oder sogar vor allem enthält, sind schwieriger zu identifizieren.
Vielleicht wollte der Patient sagen "Ich halte Medikamente für Gift"
oder "Ich werde diese Tabletten nicht mehr weiter einnehmen, weil sie mir
nicht bekommen" - "Ich habe Zweifel, ob das das richtige Medikament für
mich ist" - "Vielleicht schmecken die Tabletten so merkwürdig, weil
die Diagnose überhaupt nicht stimmt" - "Ich habe kein rechtes Vertrauen
in Ihre Behandlung" - "Ich möchte überhaupt nicht von Ihnen behandelt
werden" - "Ich glaube, mir hilft überhaupt nichts mehr."
Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, um eine Nachricht
daraufhin abzuklopfen, ob sie auch implizite Botschaften enthält?
Eine Grundvoraussetzung ist das aktive Zuhören
(siehe
S. 42  ).
Ein weiterer Weg besteht darin, sich systematisch beim Zuhören auf
das Erfassen impliziter Botschaften einzustellen, d.h. innerlich quasi
eine "zweite Antenne" für die vom Patienten gesendeten Nachrichten
aufzustellen, die auf implizite Botschaftsanteile einer Nachricht ausgerichtet
ist. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, sich bewusst darauf einzustellen,
dass Nachrichten neben expliziten Botschaften hohe Anteile impliziter Botschaften
enthalten können. Der 3. Weg ist die sorgfältige Beobachtung
nonverbaler Nachrichtenanteile, d.h. die Analyse von Mimik, Gestik und
Phonetik. ).
Ein weiterer Weg besteht darin, sich systematisch beim Zuhören auf
das Erfassen impliziter Botschaften einzustellen, d.h. innerlich quasi
eine "zweite Antenne" für die vom Patienten gesendeten Nachrichten
aufzustellen, die auf implizite Botschaftsanteile einer Nachricht ausgerichtet
ist. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, sich bewusst darauf einzustellen,
dass Nachrichten neben expliziten Botschaften hohe Anteile impliziter Botschaften
enthalten können. Der 3. Weg ist die sorgfältige Beobachtung
nonverbaler Nachrichtenanteile, d.h. die Analyse von Mimik, Gestik und
Phonetik.
Die nonverbalen Nachrichtenanteile "qualifizieren"
die Botschaften einer Nachricht. Dabei kann eine Nachricht jeweils kongruent
oder inkongruent sein. Kongruent bedeutet, dass die Botschaften
der Nachricht übereinstimmen und in die gleiche Richtung weisen, d.h.,
dass die Nachricht in sich "stimmig" ist. Bei der inkongruenten
Nachricht stehen sprachliche und nichtsprachliche Signale in Widerspruch
zueinander.
Beispiele: Das junge Mädchen, das ihrem Anbeter
den Kuss verweigert und mit zur Seite gewandtem Gesicht sagt, "Nein, denn
ich liebe dich nicht", sendet eine kongruente Nachricht aus. Der Mann hingegen,
der nach einem Sturz vom Fahrrad mit schmerzverzerrtem Gesicht aufsteht
und auf die Frage eines Passanten, wie es ihm geht, antwortet: "Das Leben
ist wunderbar", sendet eine inkongruente Nachricht.
Leider ist es häufig nicht so leicht, wie in
diesen beiden - zugegebenermaßen - überzeichneten Beispielen
dargestellt, die Kongruenz bzw., was noch wichtiger ist, die Inkongruenz
einer Nachricht zu erfassen. Auch kann der Widerspruch, in dem sprachliche
und nichtsprachliche Anteile einer Nachricht zueinander stehen, nach außen
hin relativ gering sein und nicht das volle Ausmaß der Inkongruenz
widerspiegeln.
Metakommunikation
Kommunikation läuft zwangsläufig immer auf
zwei Ebenen ab: auf der Ebene der eigentlichen Mitteilung und der Ebene
der Metakommunikation. Das Phänomen der Metakommunikation macht
zusätzlich deutlich, wie komplex der Vorgang der Nachrichtenübermittlung
in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist.
Metakommunikation bedeutet Kommunikation über
Kommunikation, also eine "Auseinandersetzung über die Art, wie wir
miteinander umgehen, und über die Art, wie wir die gesendeten Nachrichten
gemeint und die empfangenen Nachrichten entschlüsselt und darauf reagiert
haben". (F.SCHULZ VON THUN).
Metakommunikation kann ebenfalls explizit oder implizit
ablaufen. Metakommunikation im eigentlichen Sinne ist explizite Metakommunikation.
I. LANGER versucht, den Begriff der Metakommunikation durch ein Bild besser
verständlich zu machen. Die Gesprächspartner begeben sich gleichsam
auf einen "Feldherrnhügel", um Abstand von dem "Getümmel" zu
nehmen, in das sie sich verstrickt haben. Auf diesem Feldherrnhügel
der Metakommunikation machen Sender und Empfänger die Art, wie sie
miteinander umgehen, zum Gesprächsgegenstand. Explizite Metakommunikation
kann - sparsam eingesetzt - eine ausgezeichnete Methode sein, durch das
bewusste Analysieren und Ansprechen von Störfaktoren in einem Gespräch
das gegenseitige Verstehen der Gesprächspartner wieder zu ermöglichen.
Parallel zur Kommunikation auf der Mitteilungsebene
läuft immer auch Kommunikation auf der Metaebene im Sinne einer implizierten
Metakommunikation ab. Es ist der "So-ist-das-gemeint-Anteil" jeder Nachricht.
Dadurch qualifizieren sich die Botschaften beider Ebenen gleichzeitig.
J. HALEY (1978) unterscheidet dabei 4 Möglichkeiten, durch die Botschaften
einander in kongruenter oder inkongruenter Weise qualifizieren können:
Die Qualifikation durch den Kontext, die Art der Formulierung, durch Mimik
und Gestik sowie den Tonfall.
Wenn die Fürstin in TOLSTOIS "Anna Karenina"
in kühlem und trockenem Ton den jungen Ljewin mit den Worten verabschiedet
"Wir werden uns freuen, Sie zu sehen", dann erlebt der so Verabschiedete
ein klassisches Beispiel für implizite Metakommunikation. Er merkt,
dass der Sachinhalt der Nachricht ("Wir werden uns freuen ...") eine leere
Höflichkeitsfloskel ist, weil die eigentliche Botschaft durch den
Tonfall der Verabschiedungsworte zum Ausdruck kommt.
Die richtige Entschlüsselung einer Nachricht
ist daher auch wesentlich an die Fähigkeit gebunden, metakommunikative
Inhalte zu erkennen. Das Wesen impliziter Metakommunikation lässt
sich daher auf die kurze Formel bringen: "Wenn ich eine Nachricht sende,
sende ich - ob ich will oder nicht - auch eine Botschaft, wie diese Nachricht
gemeint ist" (F. SCHULZ VON THUN).
Die Nachricht hören
Dass ein Sender das, was er mitteilen möchte, als
Nachricht richtig verschlüsselt und der Empfänger die Nachricht
wiederum so entschlüsselt, wie der Sender sie gemeint hat, kurzum,
dass er also "versteht", scheint ein selbstverständlicher Vorgang
zwischenmenschlicher Kommunikation zu sein. In Wirklichkeit ist es nahezu
ein Glücksfall.
Schon die Erkenntnis, dass jede Nachricht 4 Botschaften
enthält, die ihrerseits kongruent oder inkongruent, explizit oder
implizit sein können, und dass neben Kommunikation auch Metakommunikation
abläuft, lässt berechtigte Zweifel daran aufkommen, dass Miteinander-Reden
und Sich-Verstehen ein einfaches Geschehen ist.
Die Komplexität dieses Vorgangs wird noch deutlicher,
wenn wir uns klarmachen, dass die richtige Entschlüsselung der Nachricht
durch den Empfänger voraussetzt, dass er für jede Botschaft einer
Nachricht ein eigenes Ohr besitzt, also "vierohrig" (SCHULZ VON THUN) sein
muss: Er benötigt ein Sachohr, ein Beziehungsohr, ein Selbstoffenbarungsohr
und schließlich ein Appellohr (siehe Abbildung).
Abb.: Richtiges Verstehen setzt
"Vierohrigkeit" des Empfängers voraus: a) Sachohr, b) Selbstoffenbarungsohr,
c) Beziehungsohr, d) Appellohr (modif. nach F. SCHULZ VON THUN)
Das Sachohr prüft die Nachricht unter
der Fragestellung: "Wie ist der Sachinhalt zu verstehen?" Mit dem Selbstoffenbarungsohr
möchte der Empfänger etwas über seinen Gesprächspartner
erfahren: "Was ist das für einer?" Mit dem - häufig sehr empfindlichen
- Beziehungsohr fragt sich der Empfänger: "Wie steht mein Gesprächspartner
zu mir? Was hält er von mir?" Und mit dem Appellohr horcht er die
Nachricht auf die Frage hin ab: "Was will der Sender erreichen?"
Wie unterschiedlich die Nachricht "ankommt", je nachdem,
auf welchem der 4 Ohren der Empfänger sie aufnimmt, zeigt wiederum
ein einfaches Alltagsbeispiel: Beim Frühstück fragt der Mann
seine Frau: "Wo hast du diese Wurst gekauft?"
Empfängt die Frau diese Nachricht auf dem Sachohr,
wird sie antworten: "Im Kaufhaus." Hört sie nur mit dem überempfindlichen
Beziehungsohr, dann wird sie die Frage als Kritik an ihren Hausfrauenfähigkeiten
auffassen und antworten: "Du kannst ja auch bei euch in der Kantine frühstücken."
War nur das Selbstoffenbarungsohr eingeschaltet, dann stellt die Frage
eine erneute Bestätigung der Neigung ihres Mannes zum ständigen
Kritisieren dar und wird vielleicht die Reaktion auslösen: "Musst
du denn an allem herumnörgeln?" Versteht die Frau die Frage vorwiegend
als Appell wird sie antworten: "Ich kann die Wurst ja beim nächstenmal
beim Metzger statt im Kaufhaus kaufen."
Natürlich hört der Empfänger die Nachricht
nicht nur auf einem Ohr, sondern empfängt - allerdings möglicherweise
mehr oder minder gefiltert - alle 4 Botschaften der Nachricht gleichzeitig.
Ein Grundproblem der Kommunikation besteht jedoch darin, dass es
am Empfänger liegt, ob er bewusst oder unbewusst auf einem
der 4 Ohren besonders hellhörig ist und auf welche Botschaften der
Nachricht er reagiert.
Der gesprächsgeschulte Empfänger muss die
Fähigkeit besitzen, die Nachricht, die der Sender ihm zukommen lässt,
"vierohrig" zu empfangen. Hört er nur "einohrig", also beispielsweise
nur mit dem Sachohr oder dem Beziehungsohr, weil er bewusst oder unbewusst
die anderen Ohren verschließt, kann es zu erheblichen Kommunikationsstörungen
kommen.
So neigen beispielsweise Männer in technischen
oder akademischen Berufen dazu, selektiv mit dem Sachohr zu hören
und außer dem Sachinhalt einer Nachricht keine der anderen Botschaften
zu empfangen. Ehepaare hingegen, insbesondere, wenn sie sich in einer kritischen
Phase befinden, empfangen nur noch auf dem Beziehungsohr und sind zu einer
sachlichen Aussprache nicht mehr in der Lage. Sie liegen sozusagen ständig
auf der "Beziehungslauer."
Für den Arzt ist ein gut geschultes Selbstoffenbarungsohr
besonders wichtig. Es ist sozusagen sein diagnostisches Ohr, weil
es aus der ankommenden Nachricht jene Anteile herausfiltert, die zu einem
besseren Verständnis seines Patienten beitragen können. Auch
werden beispielsweise emotionale Ausbrüche des Patienten, wenn sie
statt mit dem Beziehungsohr mit dem Selbstoffenbarungsohr gehört werden,
dem Arzt einen besseren Zugang zum Patienten ermöglichen.
Natürlich bedeutet dies nicht, dass der Arzt
das Beziehungsohr grundsätzlich "abschaltet" und nur noch mit dem
Sach- und dem Selbstoffenbarungsohr hört, denn dies würde bedeuten,
dass er den Patienten nur noch als diagnostisches Objekt betrachtet und
sich selbst der Fähigkeit, betroffen zu sein, beraubt.
SCULZ VON THUN hat auf eine weitere Gefahr hingewiesen,
wenn ausschließlich das Selbstoffenbarungsohr gebraucht oder besser
gesagt missbraucht wird, nämlich das Psychologisieren. Der
Sachinhalt einer Nachricht wird gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, sondern
nur noch unter dem Aspekt betrachtet, was für ein Mensch ist das,
der hinter dieser Nachricht steckt. Der Empfänger bewertet alle Aussagen
seines Gesprächspartners nur noch unter der Devise: "Der sagt das
ja nur, weil er so und so strukturiert ist."
Für das aktive Zuhören ist ein gut
geschultes Selbstoffenbarungsohr unerlässlich. Es gibt uns die
Möglichkeit, uns in die Gedanken- und Gefühlswelt unseres Gesprächspartners
einzufühlen, ohne ihn als bloßes Objekt zu betrachten oder ständig
als Menschen zu bewerten.
Im Gespräch zwischen Arzt und Patient kommt
dem Appellohr ebenfalls große Bedeutung zu. Viele Anliegen,
Wünsche, Hoffnungen und Absichten unserer Patienten werden nicht direkt
ausgesprochen und können, wenn das Appellohr nicht mithört und
nur eine Analyse der Sachinhalte betrieben wird, gänzlich auf der
Strecke bleiben.
Ein besonders verhängnisvolles Beispiel ist
das "Überhören" von Suizidankündigungen, die - vielleicht
zunächst noch - nur als Appell an die Umgebung gedacht sind. Ein geschärftes
Appellohr bewahrt uns davor, insbesondere Appelle "auf leisen Sohlen" im
Gespräch zu überhören.
Das Appellohr kann auch diagnostisch eingesetzt werden,
wenn wir uns einer finalen Betrachtungsweise bedienen und nach dem Zweck
einer Aussage oder Verhaltensweise fragen. Bereits Alfred ADLER bediente
sich bei auffälligen Symptomen der Methode der "Wozu-Frage", also
beispielsweise: "Wozu dient dir deine Migräne?".
Tabelle: Liegt eine Verständnisstörung
vor, sollte der Empfänger folgende Checkliste durchgehen:
-
Welche Botschaften enthielt die Nachricht?
-
Welches war die Hauptbotschaft?
-
Enthielt die Nachricht auch implizite Botschaften?
-
War die Nachricht kongruent oder inkongruent?
-
Was wurde auf der Ebene der Metakommunikation
ausgedrückt? (der "So-ist-das-gemeint-Anteil" der Nachricht)
-
Habe ich die Nachricht "vierohrig" oder nur "einohrig"
empfangen?
|
|
Der Inhalt einer Nachricht, die der Sender abschickt,
ist nicht wie bei einem Postpaket identisch mit dem Inhalt, der beim Empfänger
"ankommt". Zutreffend nennt SCHULZ VON THUN die ankommende Nachricht ein
"Machwerk" des Empfängers.
Was der eine gesagt und der andere gehört hat,
ist vielfach nicht identisch. Wir nennen das ein Missverständnis
und
sind geneigt, nach der Schuld statt der Ursache zu suchen. Verstehen, aber
auch Missverstehen, liegt im Wesen jeder Kommunikation.
| Das Wissen, dass jede Nachricht verschiedene Botschaften
enthält, und die Fähigkeit, Nachrichten vierohrig zu empfangen,
sind der beste Garant dafür, dass Missverständnisse in der zwischenmenschlichen
Kommunikation minimiert werden. |
|
Linus
Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,
Frankfurt a. Main, 1992
©
Pharma Verlag Frankfurt
Autorisierte
Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de
|